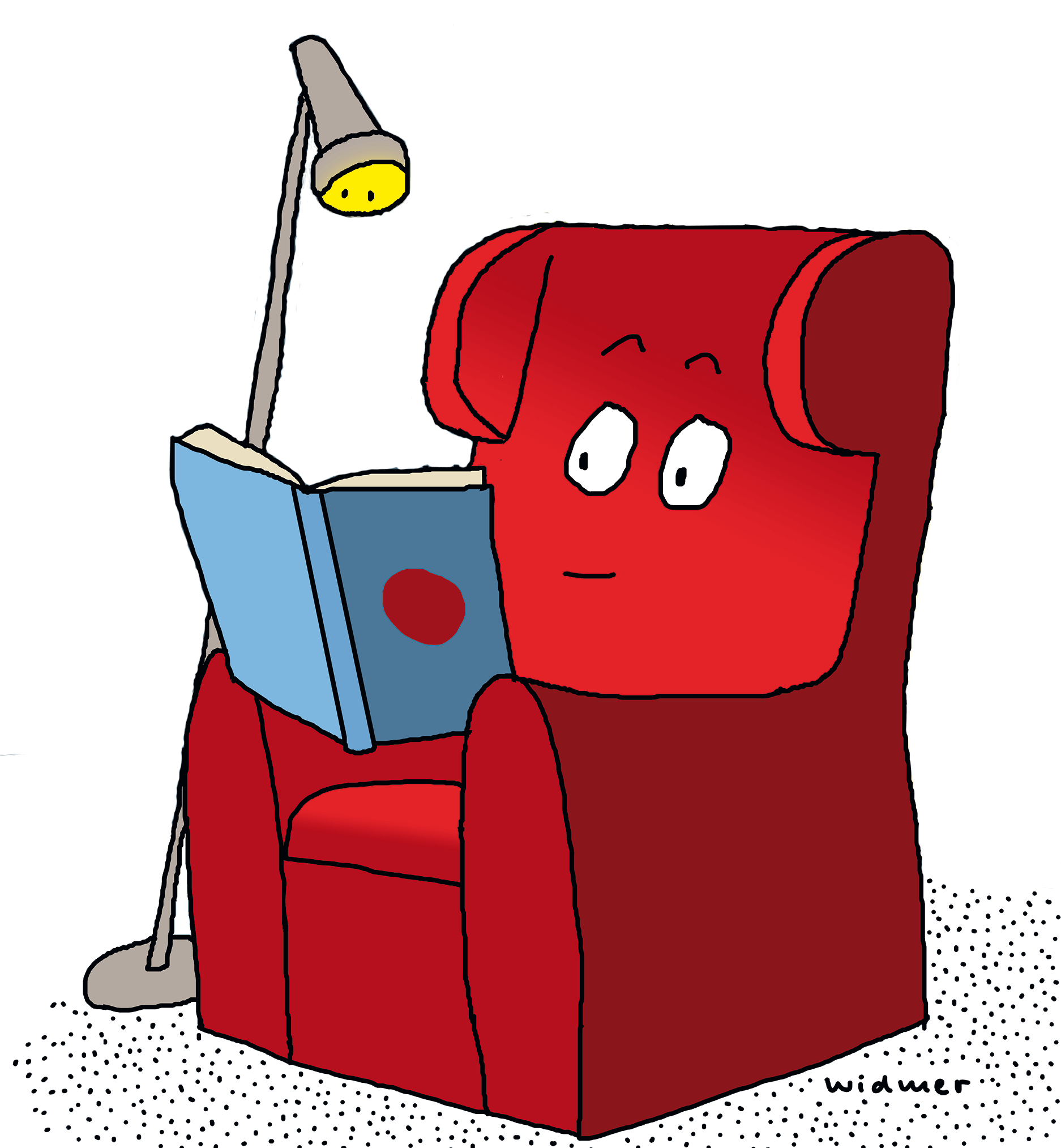Ich bin jetzt eine Woche in Quarantäne. Allein in meiner Wohnung in Leipzig, die ich gerade noch als viel zu groß empfunden habe. Inzwischen bin ich froh, dass ich hin und wieder das Zimmer wechseln kann, froh um meinen Balkon mit dem Hängesessel, in dem ich bis 13.18 Uhr Sonne habe. Es ist Sonntag, kurz nach neun. Wie soll mein Tag aussehen? Ich schreibe eine Mail an ein paar Gesundheitsämter, Leipzig, Sachsen, Berlin. Was ich schreibe, klingt lächerlich. Journalistin, Korrespondentin. Ich könnte in einer Telefonhotline helfen, schreibe ich – und dass ich zu einer Risikogruppe gehöre. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau. Niemand scheint etwas mit Sicherheit zu wissen. Alle recherchieren auf gut Glück, basteln sich aus den Informationen, die morgen schon überholt sein könnten, ein Gerüst zusammen, an das sie glauben können.
Also, was glaube ich heute? Ich glaube, dass ich im Moment nicht zu meinem Freund in die Schweiz fahren sollte, weil er als Arzt mit sehr vielen kranken Menschen zu tun hat. Ich glaube, dass ich aufpassen muss, weil ich als Kind starkes Asthma hatte und letzten Sommer eine Autoimmunerkrankung entwickelt habe. Ich glaube, dass ich irgendwas Nützliches tun sollte, ich bin ja gesund und habe Zeit dafür. Ich habe Angst, dass man mich im Moment nicht brauchen kann, dass ich nichts kann, was in dieser Krise benötigt wird.
Draußen scheint die Sonne. Mir fällt wieder ein, dass Sonntag ist. Gestern habe ich ein Video eines Bäckers aus Hannover gesehen. Mit zitternder Stimme erklärt er, dass sein Geschäft zusammenzubrechen droht – und dass Rettungskräfte künftig gratis Brötchen bekommen. Dann zitiert er ein Wandtattoo: »In a world where you can be anything, be kind.« Er weint. Ich mache mich auf den Weg zur Croissanterie, schreibe einigen Freunden, ob ich etwas mitbringen soll. In der Schlange vor dem Bäcker schaue ich auf mein Smartphone. Der weinende Bäcker aus Hannover ist inzwischen als unbarmherziger Kapitalist enttarnt worden. Er droht seinen Mitarbeitern mit Lohnkürzungen, wenn sie ohne Corona-Zertifikat daheim bleiben. Niemand hat auf mein Brötchenangebot reagiert. Ich kaufe trotzdem die doppelte Menge und beschließe, eine Freundin zu überraschen. Sie ist gerade aufgewacht und klingt, selbst durch die Gegensprechanlage, etwas überfordert. Ich lege ihr die Brötchen ins Milchkästchen. Auf dem Heimweg fällt mir ein, dass sie eigentlich kein Brot mehr isst.
Die Glocken läuten, es ist zehn Uhr. Ich versuche, mich in den Gottesdienst-Livestream zu schalten, den mein Vater seit Tagen in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe bewirbt. Das könnten sie ruhig mal beibehalten, diesen Livestream, denke ich, da würde ich öfters einschalten. Ich glaube, ich habe mich seit zwanzig Jahren nicht mehr so auf eine kirchliche Veranstaltung gefreut. Der Bildschirm bleibt schwarz. Technische Probleme, ich versuche, mich nicht zu ärgern. Darin bin ich in den letzten Tagen ohnehin ziemlich gut geworden.
Eigentlich erstaunlich, denke ich, während ich in meinem Hängesessel an meinem Croissant nuckle. Wenn sonst, in meinem normalen Leben, etwas schiefgeht, versuche ich alles, um meine Vorstellung doch noch durchzusetzen, gebe mich nicht zufrieden, solange ich nicht alles versucht habe, und kann sehr, sehr ärgerlich werden. Jetzt sind alle meine Pläne dahin, Aufträge habe ich keine mehr. Ich bin alleine, was für mich immer das Schwerste ist. Und trotzdem halte ich mich ganz gut, denke ich. Wieder so ein Gedanke, der dreißig Sekunden später komplett lächerlich wirkt. Es geht mir also ganz okay, während ich auf meinem Balkon sitze und den zweiten Kaffee trinke? Herzlichen Glückwunsch.
Ich bin zum Spazieren verabredet, erst mit einer Freundin, dann mit einer anderen. Wir treffen uns schon jetzt nur zu zweit, so wie es die Bundeskanzlerin später am Nachmittag für ganz Deutschland anordnen wird. Ein paar sonnige, kalte Stunden im Wald, Bärlauchernte, ein kleiner Hund, der seinen Besitzern immer wieder wegläuft und den ich schließlich einfangen und in die Arme nehmen kann. Ich komme durchgefroren, aber glücklich nach Hause. Bis hierhin war es ein guter Tag.
Während die Bundeskanzlerin spricht – dieser Livestream funktioniert einwandfrei – klingelt das Telefon. Eine Klinikdirektorin, die ich von einer früheren Recherche kenne. Sie kritisiert einiges, was gerade passiert, leitet mir Studien weiter und stellt meine bisherigen Glaubenssätze infrage. Vielleicht ist meine Vorsicht doch übertrieben? Ich telefoniere weiter. Eine Freundin, die nach einem Sizilienurlaub auf einer norddeutschen Insel in Quarantäne ist. Meine Eltern, die beide ein hohes Risiko haben und sich jeden Tag mehr Gedanken machen. Meine kleine Schwester, die mit trockenem Husten, einem hyperaktiven Hund und ihrem ebenfalls hustenden Freund in einer Zweizimmerwohnung am Rande von Köln ausharrt. Auf Twitter die Meldung, dass Angela Merkel sich in Quarantäne begeben muss, nachdem ihr Arzt positiv getestet wurde.
Ein Dutzend Partien Online-Schach. Meine Augen flimmern. Ich überlege, ob ich vor neun ins Bett gehen kann. Spiele noch zwei Partien. Google nach den Langzeitfolgen des Virus. Finde heraus, dass man mit einer Lungenfibrose noch etwa fünf Jahre Lebenserwartung hat. Der trockene Husten meiner kleinen Schwester vermischt sich mit dem lauten Klicken, das mein iPad produziert, als mein Gegner, dem Bild nach zu urteilen ein Teenager aus Pakistan, meine Dame schlägt. Boom, übersehen. Ich gebe auf. In meinen Ohren summt es. Ich versuche, meinen Freund zu erreichen, meine Freundin auf der Insel, irgendjemand. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich so traurig bin, es gibt keinen Grund dafür, versuche ich mir zu sagen. Doch ich kann mich nicht mehr hören, das Fiepen in meinen Ohren ist zu laut. Ich verwende in einigen WhatsApp-Nachrichten das Heul-Emoji, weine aber nicht wirklich. Irgendwann erreiche ich meinen Freund, er schaut gerade Tatort, sein Bruder ist auf dem Sofa neben ihm eingeschlafen. Ich beneide ihn um seine Gesellschaft, wir telefonieren so lange, bis ich wieder lachen kann.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Ich gehe zum Bäcker und kaufe Zimtschnecken für zwei. Ich lege meiner Freundin eine Tüte ins Milchkästchen. Sie schreibt, dass sie sich freut. Das muss reichen.
Charlotte Theile, Leipzig, Deutschland