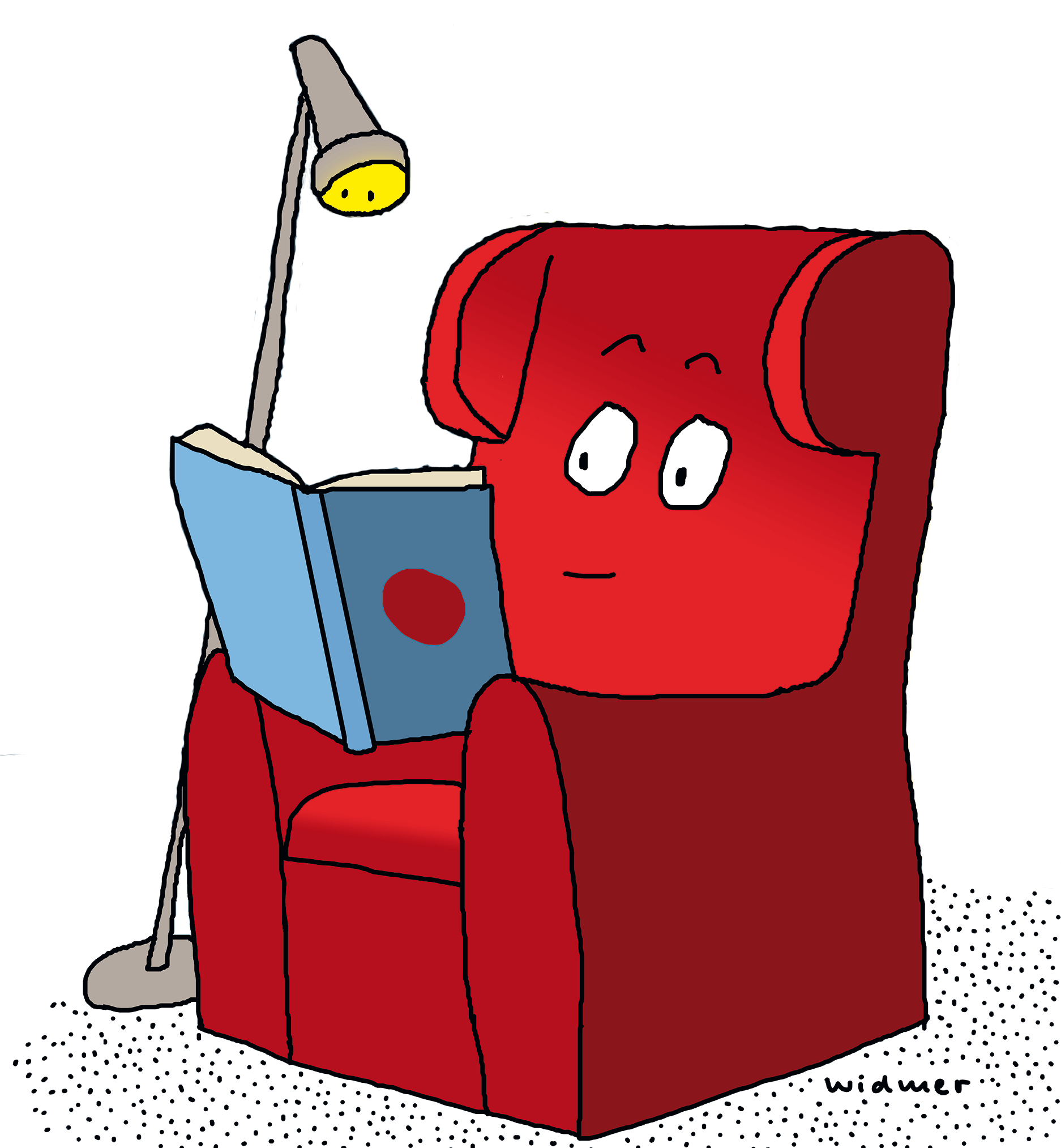Originale Version auf Englisch unten
Seit einem Monat dauert es nun schon an, dieses bizarre Experiment menschlicher Solidarität unter Einhaltung eines von Epidemiologen für angemessen befundenen Abstands. Diese Situation sei etwas noch nie Dagewesenes, sagen sie, und doch gleicht jeder Tag auf dieselbe beklemmende Weise den vorherigen. Eine Gleichförmigkeit, die ein gewaltiges Spektrum von Möglichkeiten birgt, wie man ihr begegnen kann. Manche Leute empfinden diesen Zustand als Langeweile. Für die meisten aber, so scheint es, ist jeder neue Tag auf seine Weise eine Qual.
Seit einem Monat dauert es nun schon an, dieses bizarre Experiment menschlicher Solidarität unter Einhaltung eines von Epidemiologen für angemessen befundenen Abstands. Diese Situation sei etwas noch nie Dagewesenes, sagen sie, und doch gleicht jeder Tag auf dieselbe beklemmende Weise den vorherigen. Eine Gleichförmigkeit, die ein gewaltiges Spektrum von Möglichkeiten birgt, wie man ihr begegnen kann. Manche Leute empfinden diesen Zustand als Langeweile. Für die meisten aber, so scheint es, ist jeder neue Tag auf seine Weise eine Qual.
Die meiste Zeit des Tages verbringe ich damit, den Tagesablauf irgendwie aufrechtzuerhalten. Die tägliche Routine heute ist dieselbe wie die eines jeden langen Tages des vergangenen Monats, der sich wie ein Jahrzehnt anfühlt. Ich wache auf, und schon überwältigt mich die Situation aufs Neue. Es ist wie Trauer, sage ich meinen Freunden. Es gibt kurze Momente des Aufatmens, in denen du sie vergisst, ehe sie mit all ihrem Schrecken wieder in dich hineinschneidet. Ich trinke eilig einen Kaffee und bringe mich nebenbei auf den neusten Stand der Apokalypse. Panik, Traurigkeit, Sorgen und kleine Hoffnungsschimmer flackern alle gleichzeitig auf. Ich schicke meiner Freundin, die allein mit ihrer Trauer in ihrem New Yorker Apartment eingeschlossen ist, eine Textnachricht. Vor ein paar Tagen hat Covid-19 ihre Mutter getötet. Sie starb innerhalb ein paar fiebriger Stunden, und nun hält dasselbe Virus meine Freundin davon ab, zur Beerdigung zu fahren. So respektvoll, wie es eben geht, versuche ich ein wenig Optimismus über die tröstende Wirkung auch einer virtuellen Bestattungszeremonie zu verbreiten, die sie und ihre Angehörigen jeweils an verschiedenen Orten am Bildschirm mitverfolgten. Drei Pfarrer, auf eine absurde Art strahlend vor Gold und Traurigkeit, sangen etwas scheppernd einen Choral, und es klang eindringlich, tief empfunden, voller Zuneigung.
Eines der vielen Dinge, vor denen wir uns fürchten, ist eingetreten.
Meine täglichen Spaziergänge durch die Stadt haben eine neue Bedeutung erfahren. Noch mehr als sonst fühle ich mich ein bisschen wie eine Touristin, wenn ich die nervösen Straßen durchquere, um Lebensmittel einzukaufen. Diese einstmals profane tägliche Aufgabe ist mit einem Mal kostbar geworden und mit Gefahr belegt. Bevor ich das Haus verlasse, binde ich mir das blau-weiße Tuch um Mund und Nase und empfinde dabei einen flüchtigen Anflug von Freude. Solche Tücher trugen die Zapatisten im südlichen Mexiko, um anonym zu bleiben, als sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit traten und die kapitalistische Globalisierung anprangerten. Hier in dieser gediegenen kanadischen Verwaltungsstadt teilt wohl kaum jemand diese Assoziation beim Anblick so einer Gesichtsverhüllung, aber zumindest mich bringt sie zum Lachen, wenn ich mich so im Spiegel sehe. Der Angst ins Gesicht lachen – mehr als zwei Jahrzehnte sind nun schon vergangen, seit die Zapatisten mit dieser radikalen Geste erstmals in Erscheinung getreten sind. Heute reichen sie dieses Geschenk an mich weiter, während ich mich aufmache, um die paar Blocks zum Gemüseladen zu laufen. Die Zapatisten waren es, die mich dazu brachten, mir erstmals ernsthaft Gedanken über die Frage von Angst in der Stadt zu machen. »Diese Stadt ist krank«, schrieb Don Durrito, eine der vielen imaginären Figuren aus Subcomandante Marcos’ Botschaften aus dem lakandonischen Urwald, über einen Besuch in Mexiko-Stadt. »Diese Stadt ist krank vor Angst und Einsamkeit.« Es ist wohl ziemlich passend, dass mir diese Zeile jetzt wieder in den Sinn kommt, unterwegs zu ein paar mit Gefahren behafteten Besorgungen, während ich gleichzeitig alle Menschen meide, die nicht zu meinem Haushalt gehören. Jede Stadt der Welt scheint jetzt auf diese Weise krank zu sein, ängstlich und isoliert.
Im Laden angekommen, packe ich Äpfel, Petersilie, Schokolade, Eier und Brot in meine schon etwas abgewetzte Einkaufstasche. Vor ein paar Wochen noch hätte diese Szene für Aufsehen gesorgt, wahrscheinlich hätte mich jemand von hinten an der Schulter gepackt, mich aufgefordert, die Waren auszuhändigen, vielleicht hätte man sogar die Polizei gerufen. Heute schert sich niemand darum. Im Grunde sind alle froh. Je weniger Kontakt, desto besser.
Alles andere ist ebenso seltsam. Das Murmeltier, dem ich im Park beim Fressen begegne, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen; ein langer Winter liegt verheißungsvoll vor ihm. Im Netz zirkuliert in diesen Tagen ein Video von einem anderen stadtstreunenden Murmeltier, diesmal in Philadelphia, das herzhaft in ein Stück Pizza beißt, das es in einer Mülltonne gefunden hat. Allerorts tauchen Anzeichen dafür auf, dass eine neue Ära angebrochen ist: In den Parks stehen offizielle Warnschilder, die die Leute dazu auffordern, Abstand zu halten, sich nicht hinzusetzen, keinen Müll zu hinterlassen. Wie man hört, verhängt die Polizei saftige Strafen gegen alle, die sich nicht daran halten. Ein Graffiti fordert, was derzeit alle denken, aber niemand auszusprechen wagt: »Lasst die Reichen für Covid-19 bezahlen!« An den Laternenpfosten kleben Flugblätter, die zum Boykott der Mietzahlungen aufrufen.
Die Leute blicken sich verunsichert an, wie um sich darüber zu verständigen, wie man jetzt noch so etwas wie Solidarität, Freundlichkeit im Umgang miteinander pflegen kann, wo doch alle unsere gewohnten Gesten als tödlich taxiert sind. Und doch: An der Oberfläche wirkt der Rhythmus der Stadt ruhig, bedächtig, fast friedlich. Keine Spur von der schmerzhaften Einsamkeit, die uns auf Schritt und Tritt verfolgt.
Bleibt zu Hause.
-------
We are one month and change into this bizarre experiment in human solidarity at an epidemiologically approved distance. Unprecedented, they say, yet each day is met with a gripping sameness. A monotony that promises an unfathomable range of possible outcomes. Some seem to be experiencing this as boredom. Most seem to experience it as another day, another way, in which to feel a new kind of anguish.
I spent most of my day holding it together. My daily routine today is the same as it has been for each long day of the last month, which feels like a decade. I wake up and the situation washes over me anew. It’s like grief I tell my friends. You forget for a moment of respite and then terribleness of what is happening slices into you. I drink coffee quickly and embark on the ritual routine of catching up on the apocalypse. Panic, sadness, worry, and flickers of hope appear all at once. I text my friend who is trapped and grieving in her New York apartment. A few days ago, COVID – 19 killed her mother. She was gone in a few fevered hours and now the same virus prohibits my devastated friend from attending her funeral. I try to be respectfully upbeat about the healing powers of even a virtual funeral, which she watched from afar alongside her scattered loved ones. Three priests, improbably resplendent in gold and sadness, sing a creaky hymn and it sounds lovely, haunting, deeply felt.
One of the many things we all fear happened.
My daily walks through the city have taken on new meaning. I feel like a tourist even more than usual, as I traverse these nervous streets. Before leaving the house, I felt a fleeting charge of pleasure as I tied my blue and white bandana around the lower half of my face in preparation to go to the store to buy food. This once mundane daily task is suddenly rare and haunted by danger. The bandana is like the kind worn by the Zapatistas in southern Mexico when they appeared in anonymously in public for the first time to denounce capitalist globalization. This iconic face covering that would go unrecognized as such in this staid administrative town, but at the very least, it lets me laugh at myself. More than two decades ago, the Zapatistas excelled in the art of radical laughter in times of great suffering and fear. And today they are passing this gift along to me as I walk a few blocks to the grocery store. The Zapatistas were the ones who first got me thinking seriously about fear in the city. “This city is sick”, wrote Don Durrito, a beetle from the Lacondon Jungle and one of Subcomandante Marcos’ many imaginary characters in a letter to Marcos from a visit to Mexico City. “This city is sick with loneliness and fear.” Recalling this line in my obligatory face covering as I go to fetch my perilous groceries while I stay far from anyone I’m not living with, is fitting I suppose. Every city in the world seems to be overflowing with the sick, fearful and separated.
Once I’m at the store in my palicate I stuff apples, parsley, chocolate, eggs, and bread into my raggedy canvas shopping bag. Just a couple of weeks ago, this scene would have aroused fear, provoked a stern hand on the shoulder, a demand to turn over the goods, if not a call to the police. Today, nobody gives a shit. Actually, they’re happy for it. The less contact the better.
Everything else is just as weird and jarring. The marmot I encounter, munching on fresh grass is oblivious and seemingly happy about the promise of the close to another long winter. I wish I could show it the video that’s circulating today of another city-dwelling marmot, this one in Philadelphia, heartily eating a slice of pizza retrieved from a garbage. Other signs of a new season appear elsewhere: official warnings have appeared in the parks, sternly instructing people to keep moving and stay away from one another. Word is circulating that the police have started issuing hefty fines for lingering and violating these new rules. A scrawl of graffiti announces, as usual, that which nobody with power dares utter these days and that everyone else is surely thinking: “let the rich pay for COVID-19!”. Battered posters calling for a city-wide rent strike appear on lampposts.
People look at each other anxiously as if trying to figure out how to communicate solidarity, friendliness, when all our established modes of expressing these feelings among strangers and loved ones alike are suddenly designated as lethal. Yet on the surface, the city’s rhythm feels quiet and reserved, almost peaceful, not a word of the painful illness stalking us all everywhere we go.
Stay indoors, stay inside, don’t leave the house.
Fiona Jeffries, Ottawa, Kanada
Aus dem Englischen von Sarah Wendle