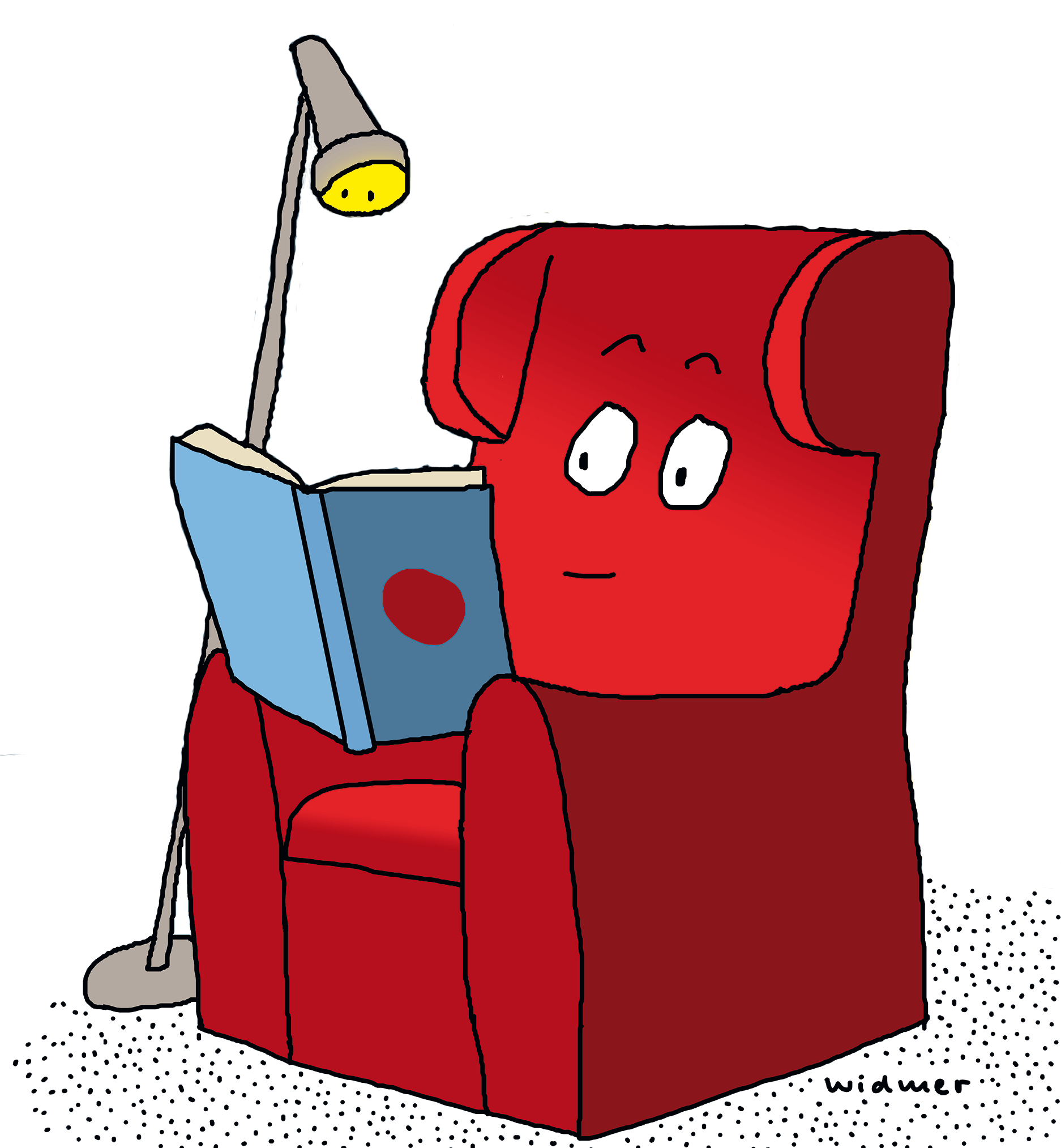Warum können die die Türen nicht automatisch öffnen, ärgert sich F., damit nicht alle auf den blöden Knopf drücken müssen. Sie schaut mich an. Das war zu Beginn, in Woche eins oder zwei.
Inzwischen öffnen sich die Türen von selbst.
Allerdings fährt kaum noch jemand Straßenbahn.
Ich stelle mir vor, wie ich als letzter Passagier in der Straßenbahn sitze: An jeder Haltestelle ein Ballett lautlos auseinanderstrebender und wieder zusammenfindender Türflügel.
Manchmal ertappe ich mich, wie ich eine heimliche Freude verspüre beim Gedanken, dass der Wahnsinn der Normalität nun für immer ausgehebelt sein könnte. Eine Erleichterung über die Befreiung von selbst auferlegten Pflichten.
Dann wundere ich mich über mich selbst.
Draußen ist Frühling.
Eine Frau fotografiert sich vor der Kulisse der rosa blühenden Bäume: Selfie mit Kirschblüten und Atemschutzmaske.
Seit Tagen gehe ich mit demselben Abholzettel zur Post, nur um festzustellen, dass die Warteschlange vor der Filiale nicht kürzer geworden ist. Markierungen auf dem Asphalt geben die Abstände vor. Einige der Wartenden halten Pakete in den Armen: Rückgaben an den Rosinenbomber.
Unterwegs machen Menschen einen Bogen um mich. Jedes Mal fühle ich mich einen Moment lang ungeliebt, weil gefährlich.
Am Eingang zum Supermarkt erhalte ich nach dem Händedesinfizieren einen einzelnen Plastikhandschuh für den Traggriff des Einkaufkorbs. Eine Kundin stellt den halb vollen Korb ab, greift mit der im Handschuh steckenden Hand nach einem Apfel, begutachtet ihn. Dann legt sie den Apfel zurück für den nächsten Kunden.
Die Leere wechselt täglich die Regale. Toilettenpapier wäre wieder zu haben. Dafür gibt es kein Salz mehr. Und keine Kondome.
Eine Woche vor Ostern war ich im Tessin, um die von einer Gerölllawine mitgerissene Wasserleitung zu reparieren. Das Haus steht allein auf einer Waldlichtung in einem abgeschiedenen Tal, ohne Internet, ohne Stromanschluss, der perfekte Rückzugsort, rechtfertige ich mich vor mir selbst, während ich mit dem Auto über die leere zweispurige Autobahn Richtung Gotthard rausche, vorbei an Stauwarnungen und Überholverboten und Ampeln zur Regulierung von Verkehrsströmen, an der Leuchtschrift: BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE!
Beim Aufstieg zur beschädigten Leitung ringe ich nach Luft, frage mich, ob das von den Blütenpollen kommt. Plötzlich steht ein Unbekannter vor mir, mitten im Wald, streckt mir zur Begrüßung seine Hand entgegen.
Die Erde ist leiser geworden, wird ein Erdbebenforscher in der Zeitung zitiert. Der menschengemachte seismische Lärm hat abgenommen.
F. erzählt von einer Videokonferenz mit zahlreichen Teilnehmenden. Auf ihrem Bildschirm eine Galerie von Köpfen vor Wohnzimmerwänden. Im Verlauf der mehrstündigen Sitzung sei es in einigen Zimmern immer dunkler geworden.
Ich erhalte Einladungen zu Online-Tanzklassen. Ein Freund veranstaltet eine virtuelle Geburtstagsfeier. Meine Winterliebe hat mich verlassen, schreibt er.
Das Gegengewicht zur pompösen Stille in der Innenstadt: die Betriebsamkeit in der Blockrandsiedlung, in der ich wohne. Auf dem Nachbarbalkon, exakt zwei Meter entfernt, blinzelt N. rauchend in die Mittagssonne, mit zerzauster weißer Mähne und struppigem Bart, als wäre er gerade aufgestanden. Er hebt müde die Hand zum Gruß. Was will man machen, sagt er.
Im Haus gegenüber füllt die Nachbarin, deren Namen ich nicht kenne, Erde in Tontöpfe, kleine Häufchen zwischen behutsam gefalteten Händen. Setzlinge sehe ich keine. Vielleicht bestellt sie die Pflanzen im Internet.
Um fünf beginnt das Balkonstraßenfest.
Die WG schräg unter mir hat Boxen ins offene Fenster gestellt. Technobeats hämmern. Von oben sehe ich Füße in senfgelben Socken über die Brüstung baumeln. Auf den gegenüberliegenden Balkonen Nachbarn, trinkend, rauchend, mitwippend.
Die Frau mit den Tontöpfen schaut herüber. Ich deute ein Winken an. Sie sieht es nicht. Oder tut zumindest so.
Die Stimmung ist nicht ganz so ausgelassen wie auf den verwackelten Aufnahmen von Menschen, die auf ihren Balkonen in Italien tanzen. Allerdings dürfen wir hier unsere Wohnungen auch verlassen.
Bei Einbruch der Dunkelheit gehen überall Lichter in den Fenstern der Nachbarhäuser an, die sonst mit leerem Blick in die Nacht starren.
Mir fällt ein, dass ich kein Mitbringsel habe für das Abendessen bei F.
Ich steige aufs Rad.
In der Hofausfahrt versperrt mir die jüdische Ambulanz mit blinkenden Warnlampen den Weg. Bärtige Männer mit Schläfenlocken und Kippa schlüpfen in Schutzanzüge, taumeln wie Aliens durchs pulsierende Licht.
Beim Automaten ein paar Straßen weiter steige ich ab. An der Glasfront klebt ein handgeschriebener Zettel: DER BLUMENAUTOMAT BLEIBT IN BETRIEB.
Matthias Amann, Zürich, Schweiz