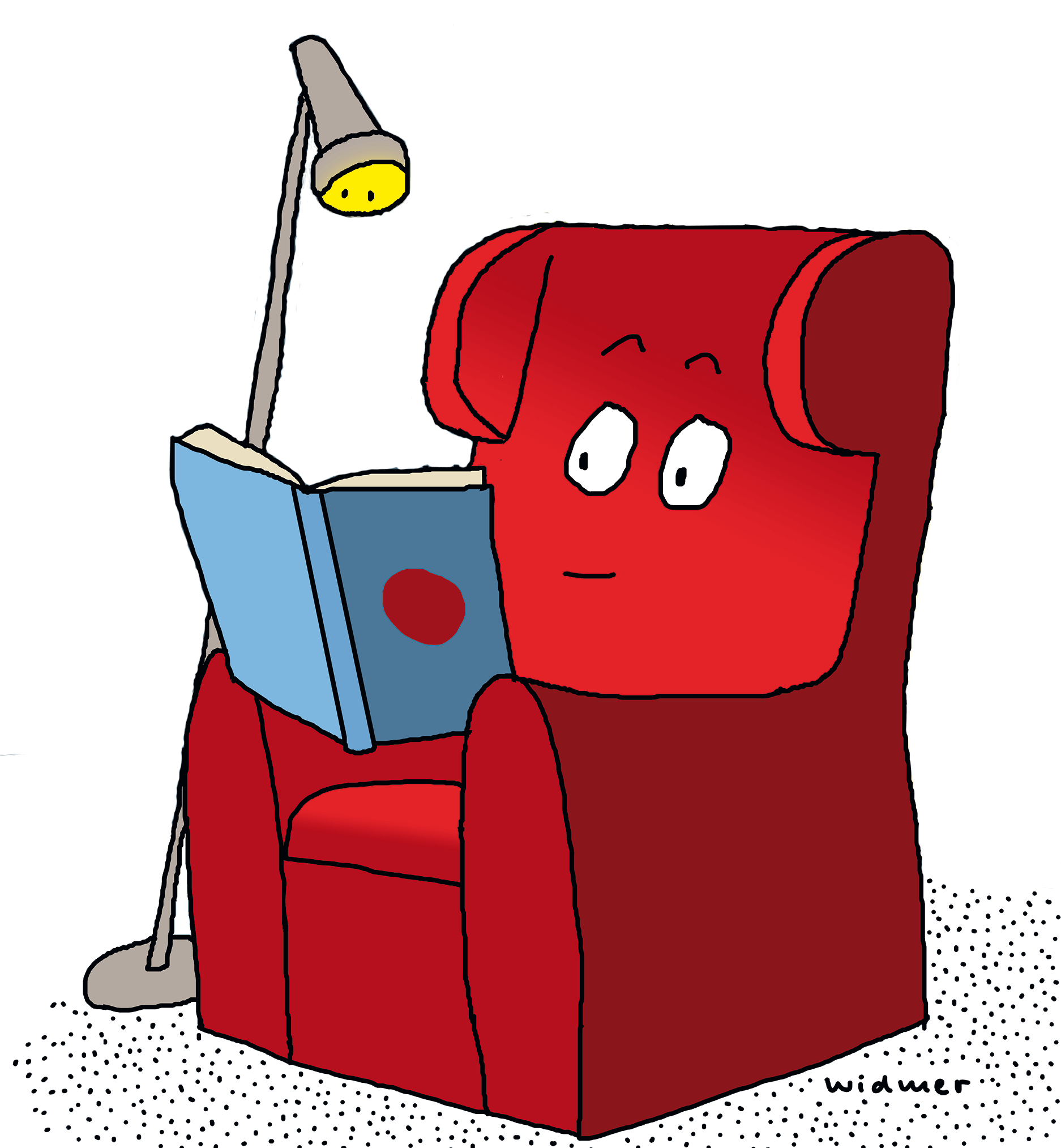Heute bin ich zum ersten Mal wieder nach Zürich gefahren, eine Freundin treffen. Von unserer Kleinstadt aus bin ich in 25 Minuten mit dem Zug im Bahnhof Stadelhofen. In normalen Zeiten fahre ich mindestens zwei- oder dreimal wöchentlich stadtwärts, Zürich ist mein sozialer und kultureller Bezugsort. Und jetzt ist die Stadt plötzlich zu einem Sehnsuchtsort geworden. Einfach nach Zürich fahren. Einfach eine Freundin treffen. Ein Stück Normalität wiederherstellen.
Ich spazierte das Limmatquai hinunter, hörte die schrillen Rufe der Mauersegler, die um die Türme des Grossmünsters jagten, sonst war es still, wie früh an einem Sonntagmorgen. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass auf dem Dachgiebel des Zunfthauses zur Haue ein Hirsch thront. Was will denn der am Versammlungsort der Zunft zum Kämbel, deren Wappen über den Arkaden ein Kamel zeigt?
Fast normal fühlte es sich an, mit C. durch die Stadt zu spazieren und im Gespräch von Thema zu Thema zu springen, im Wechsel von Gewichtigem zu Trivialem und wieder zurück. Heute wird in Israel der Gedenktag für den Holocaust begangen. In diesem Zusammenhang kamen wir auf das neue, demnächst auf Deutsch erscheinende Buch Israel – eine Utopie von Omri Boehm zu sprechen, einem Philosophieprofessor, der in New York lehrt. Boehm setzt sich kritisch mit der Frage des Gedenkens auseinander – sowohl an den Holocaust wie an die Naqba. Israelische Schulkinder, schreibt er, lernen von der ersten Klasse an, dass die Existenz Israels die Wiederauferstehung des Volkes nach dem Holocaust bedeutet. Boehm thematisiert den Missbrauch der Erinnerung, der zu einer rassistischen Politik und zu rassistischen Gesetzen führen kann. Er erinnert an den Wissenschaftshistoriker Yehuda Elkana, selber ein Holocaust-Überlebender, der 1988 das politische Pamphlet »Über die Notwendigkeit, zu vergessen« schrieb. Elkana postulierte, dass eine Lehre aus dem Holocaust, wenn es denn eine solche geben solle, heißen müsse: Das darf nie mehr geschehen, und nicht: so etwas darf uns nie mehr passieren. Die Existenz von Demokratie an sich sei gefährdet, wenn die Erinnerung an die Toten aktiven Anteil am demokratischen Prozess nehme.
Zurück im Zürcher Oberland. Wir sind zu zweit, das macht vieles einfacher, zumindest, wenn man sich gut versteht. Heute einmal kein Spaziergang in den Hügeln der Umgebung, dafür sitzen wir im Garten. Bei so viel Häuslichkeit entgeht mir kein neues Pflänzchen, das macht Freude. Die Tage fliegen davon, schon ist wieder Abend. Neue Routinen haben sich eingebürgert, eigentlich bin ich immer beschäftigt. Es heißt, dass auch im Gefängnis die Zeit davoneilt, die eingeschränkten Routinen, die bekannten Wege lassen die Zeit schneller verstreichen.
Vieles bereitet mir Mühe. Dass wir die Kinder nicht treffen können, die Enkeltochter. Wir gehören zur Risikogruppe der über 65-Jährigen. Es ist auch kränkend, dass es gut ohne uns geht. Dass wir die Krise einfach aussitzen sollen, möglichst zu Hause. Unsere Stellung im Pandemieplan ist gut begründet, hat aber auch etwa Entmündigendes. Neulich fing ich in der Apotheke eine arge Schelte ein, weil ich die Medikamente selber holte, statt sie mir bringen zu lassen. Dabei entging mir, dass etwas fälschlicherweise verrechnet wurde. Ich rief an, der Sachverhalt wurde abgeklärt und die nette Apothekerin meinte eindringlich: »Frau Elam, wir legen ihnen das Geld in einem Couvert in den Briefkasten. Sie müssen keine Angst haben, es ist ganz sicher.« Ob so viel Fürsorglichkeit ist mir ganz anders geworden, nämlich ärgerlich, und ich habe mich altersdiskriminiert gefühlt wie damals am Bahnschalter, als die junge Schalterbeamtin »Bravo!« sagte, als ich den Betrag am Kartenterminal richtig eintippte.
Meine Tage sind lang. Oft bin ich schon wach, wenn der erste Vogel, das Rotkehlchen, zu singen beginnt. Am Abend wird es spät – ich werde wieder kaum vor Mitternacht ins Bett kommen. Es ist wie bei einer Fresssucht. Ich werde von meinem Tag einfach nicht satt. Es fehlt zu viel vom nährenden Leben.
Sibylle Elam, Rüti ZH, Schweiz