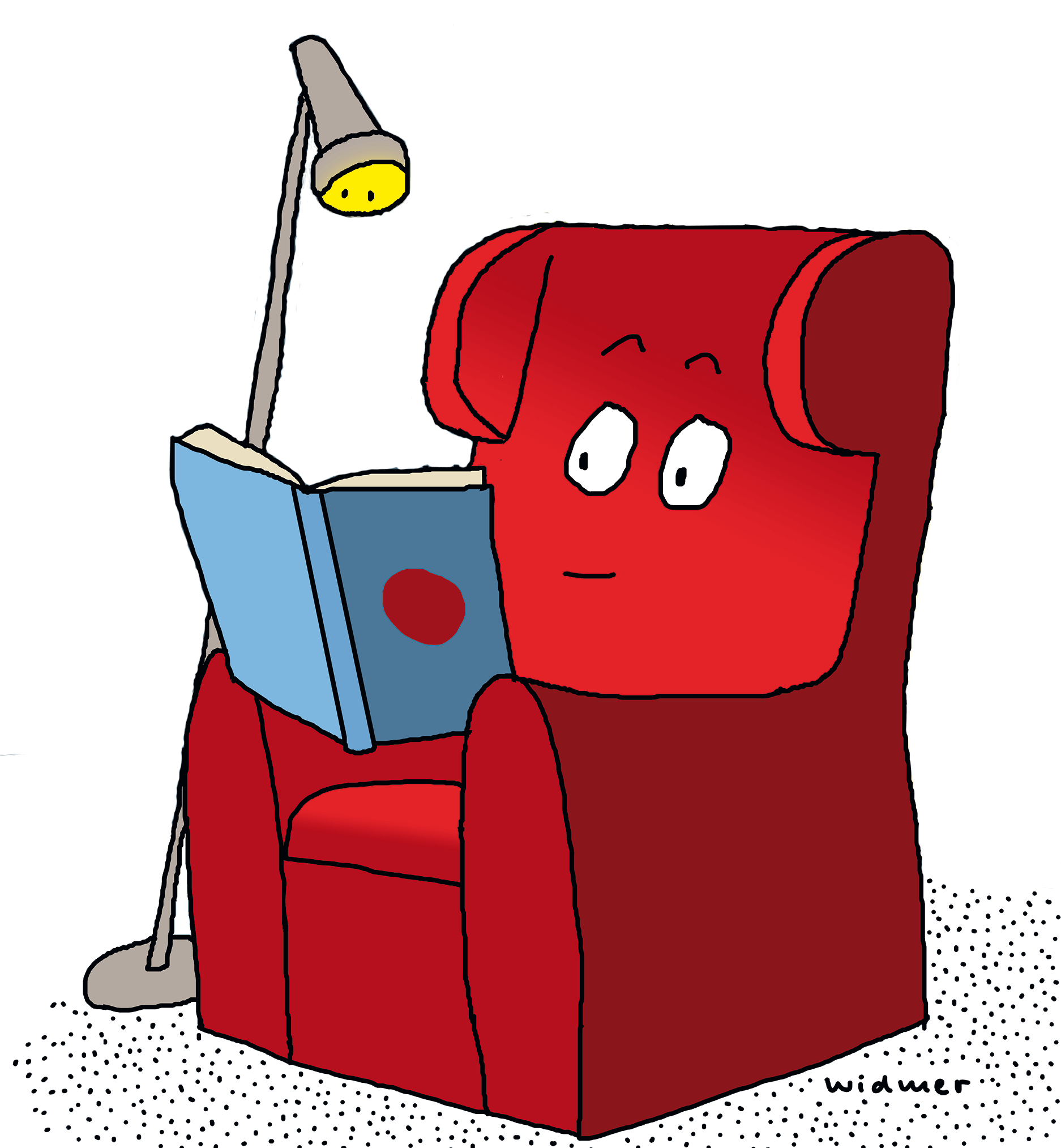Die Nachrichten dringen herein in die Glocke, unter der wir derzeit sitzen; es sind für meinen Geschmack zu viele zum Thema Corona, und ich versuche, deren Konsum zu rationalisieren. Aber natürlich gibt es Nachrichten, die man nicht ignorieren kann. Eine solche war heute die vom Tod des chilenischen Schriftstellers Luis Sepúlveda, der dem Virus, mit dem der Siebzigjährige mehrere Wochen gekämpft hat, erlegen ist. Ende Februar war er an einem Literatur-Festival in Portugal, und bei seiner Rückkehr nach Oviedo, Asturien, wo er seit 25 Jahren lebte, traten die Symptome auf. Er war in Asturien der erste positiv getestete »Fall«.
Das Verstummen dieser sehr lateinamerikanischen literarischen Stimme ist schmerzlich. Er hatte nicht immer und überall gute Presse, aber er war einer der meistgelesenen Autoren Lateinamerikas. Sein 1989 erschienenes Buch Der Alte, der Liebesromane las ist in 50 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft worden. Darin beschreibt er Leben und Kultur der Shuar, Ureinwohner im Amazonas-Gebiet, und das zerstörerische Eindringen kapitalistischer Rohstoffjäger in diese Welt. Zuvor hatte Sepúlveda mehrere Jahre mit den Shuar gelebt und, wie er gesagt hat, dort gelernt, dass er mit seinem Vulgärmarxismus, der am liebsten über den ganzen Kontinent einen Einheitssozialismus gelegt hätte, auf dem Holzweg war: Das Wichtigste und Interessanteste sei doch die ungeheure Kultur- und Naturvielfalt des Kontinents.
Wir haben 2011 im Rotpunktverlag Sepúlvedas Roman Der Schatten dessen, was wir waren herausgegeben. Er erzählt die Geschichte von drei Freunden, die 35 Jahre nach Pinochets Putsch aus dem Exil nach Chile zurückkehren mit einem Plan in der Tasche: Sie wollen einen Dollarschatz heben, den eine linke Guerilla kurz vor dem Putsch versteckt hatte, und zwar an der gleichen Stelle, an der 1925 die Beute aus einem Banküberfall in Santiago de Chile zwischengelagert worden war – von vier Anarchisten, darunter dem legendären Spanier Buenaventura Durruti, der den Bankangestellten verkündete: »Das Geld, das wir mitnehmen, wird die Verdammten dieser Erde beglücken.«
Durruti und seine Kumpane hatten übrigens auch in Mexiko Banken ausgenommen. Sepúlveda erzählt an anderer Stelle die Geschichte, wie Durruti mit dem Geld aus einem Überfall eine große Menge Bücher einkaufte und diese per Schiff nach Spanien transportieren ließ, damit in einem Armenviertel eine Bibliothek eingerichtet werden konnte. Die Spanier aber hätten herausgefunden, dass die Gabe illegal war, und sie zurückgewiesen, worauf Durruti ihnen erklärte, er habe das Geld klauen müssen, denn von sich aus hätten sie es ihm ja nicht gegeben. Ob die Geschichte so stimmt, weiß ich nicht, aber dass Sepúlveda seine Freude dran hatte, ist klar.
Er selbst war als ganz junger Mann bei den Allende-Sozialisten aktiv, verbrachte dann zweieinhalb Jahre in den Kerkern Pinochets, ging 1980 ins Exil, zunächst nach Deutschland. Was er zum Exil gesagt hat, kam nicht bei allen SchriftstellerkollegInnen gleich gut an. Dank des Exils habe er viele Länder, Kulturen, Lebensgeschichten kennengelernt. Er habe die Welt studieren können. Das Exil sei wie ein Stipendium, das die Diktatur ihm gewährt habe.
Dennoch sind die Stoffe seiner Geschichten fast immer lateinamerikanisch, und er behandelt sie nach dem Credo, das er so formulierte: »Immer schon und heute noch erzählt der gute Roman die Geschichte der Verlierer, denn die Gewinner erzählen ihre Geschichte selbst. Für uns Schriftsteller gehört es sich, die Stimme der Vergessenen zu sein.«
Seine Bücher nimmt uns das Virus nicht weg. Es lohnt sich, wieder einmal eins zur Hand zu nehmen.
Andreas Simmen, Zürich, Schweiz