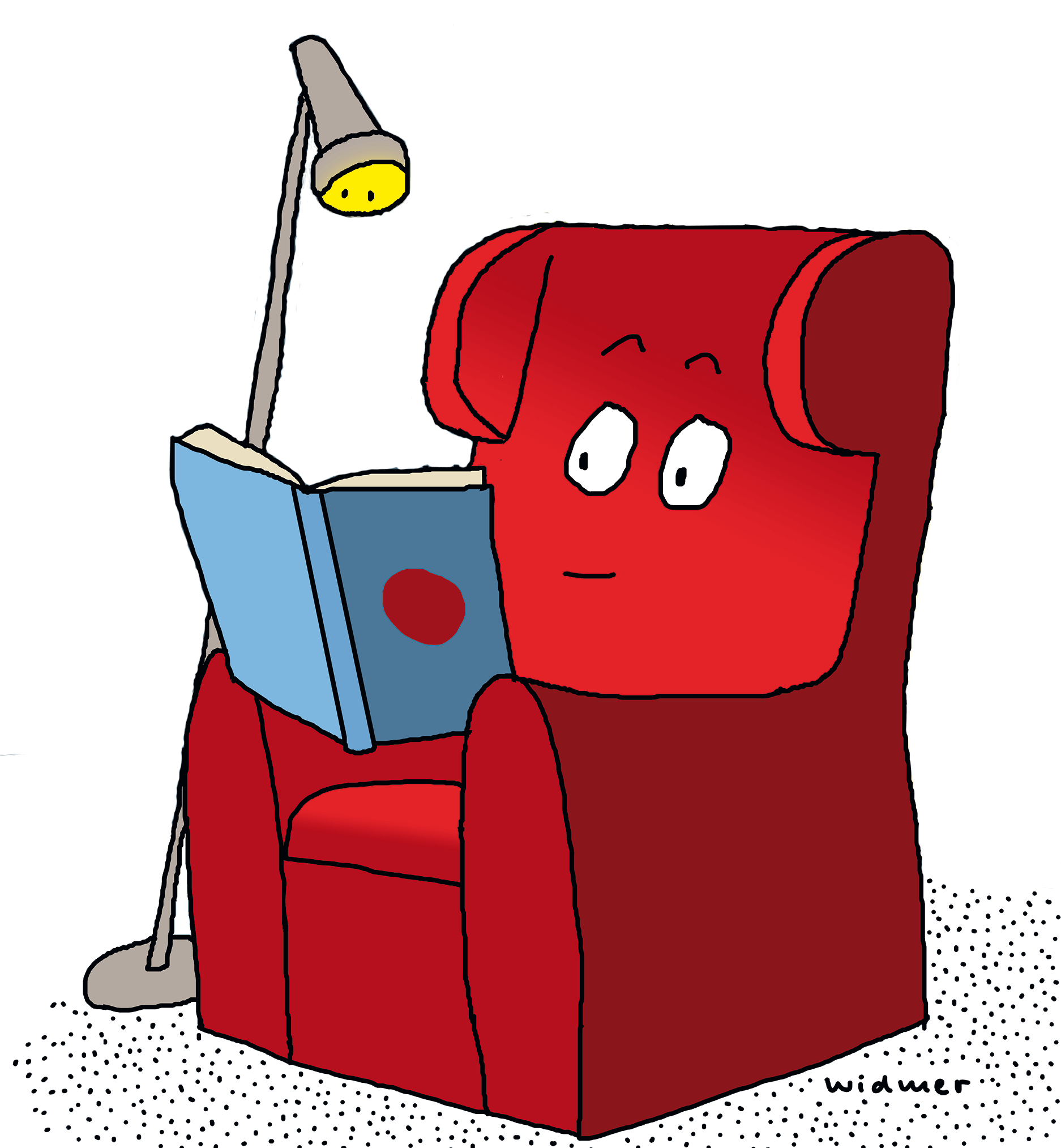Am Nachmittag des 7. April 1724 sitzen auf den Rängen und im Chor der Nikolaikirche von Leipzig die Musiker und stehen die Sänger. Ob es still war, gespannte Ruhe wie heute, wenn die Johannespassion aufgeführt wird? Immerhin sitzen und stehen über 2500 Menschen in der dreischiffigen Halle und auf den großen Emporen. Johann Sebastian Bach gibt den Einsatz zum dramatischen Vorspiel. Die Basslinien pulsieren, die Geigen wirbeln, dissonant halten zwei Flöten und zwei Oboen mit. In nur neun Takten erfüllt das Orchester den riesigen Raum mit Musik, in der sensible Gemüter zu hören meinen, wie die römischen Kriegsknechte Jesus in Golgatha ans Kreuz nageln. Die Basslinien steigen ab, das Orchester schwillt an. Ich stelle mir vor, wie Bach sich zurücklehnt und kräftig die Arme hebt, denn der Chor muss nun mit drei Rufen jubilieren: »Herr, Herr, Herr«. Und dann leiser werden: »Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist.« Die Johannespassion erschüttert mein Herz, mein Gemüt und meinen Verstand. Keine Musik aus meinem nun schon fünfzig Jahre langen Musikleben hat die Kraft und die Schönheit dieser Passion.
Von Frühling bis Herbst hat mein Musikleben Platz für vieles von Kasimir Geisser bis Jimi Hendrix. Johann Sebastian Bach aber bestimmt mein Musikhalbjahr von Herbst bis Frühling. Immer am letzten Novembersonntag beginne ich das Weihnachtsoratorium zu hören, im Dezember des einen Jahres reise ich in eine Stadt, wo ein Weltorchester es aufführt. Im anderen Jahr besuche ich eine Kirche auf dem Land, wo ein Kirchenchor mit einem Amateurorchester »jauchzet, frohlocket«. Im Januar versorge ich die CD. Ende Februar besorge ich mir neue Einspielungen der Passionen, letztes Jahr die nach Matthäus, dieses Jahr ist Johannes-Jahr. Meinen Ausflug gestern in die Schlosskirche nach Friedrichshafen hat das Coronavirus allerdings gestrichen. So hörte ich mir in meiner Stubenschatulle ein Livekonzert aus der Suntory Hall in Tokio mit dem Bach Collegium Japan unter der Leitung von Masaaki Suzuki an. Und ich staunte, wie japanische Sängerinnen und Musiker diese tiefst europäische, protestantische Musik singen und spielen können.
John Eliot Gardiner hat als Dirigent maßgebende Aufführungen und Einspielungen der Johannespassion gemacht. Er hat auch das mir liebste Buch über Johann Sebastian Bach geschrieben. Da der Mensch auch hört, was er weiß, lese ich in meinem Bach-Halbjahr in diesem Mocken. Er schreibt, dass die Johannespassion »ohne Frage ein Akt des Glaubens« sei. Das trifft nicht zu für mich, denn ich habe auf meinem Lebensfaden diesen »Akt« verloren. Sie ist aber eine Quelle von Zuversicht für mich, den Agnostiker. So wie der Eingangschor mich überwältigt, treibt mir der letzte Chor nach fast zwei Stunden die Tränen in die Augen: »Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine«, ein komplexes Gefüge aus Klängen tanzt als warmer, lyrischer Trost durch das Kirchenschiff, oder jetzt eben durch die hölzerne Stube. Auch wenn ich nicht religiös bin, die kulturelle Kraft der Passionsgeschichte in Bachs Musik berührt und beeindruckt mich. Nachdem mit allen Mitteln der Kunst und großem dramatischem Gespür die Geschichte des Mordes an Jesus aufgeführt ist und mit dem letzten Chor aus der Grabesruhe Musik geworden, beleuchtet Johann Sebastian Bach nun Ostern bengalisch: die große Hoffnung, dass alles ewig gut kommt.
Seit der Uraufführung der Johannespassion hat die Welt viele Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Zerstörungen, Katastrophen erlebt. Aber auch Hoffnung – die Nikolaikirche war 1989 ein Ort, wo der gewaltlose Untergang der DDR geschah. Heute, am Karfreitag, in dieser mich ab und zu überwältigenden Corona-Zeit, vermag die Johannespassion mich zu trösten. Und ich freue mich auf den 8. März 2021, dann werde ich im Opernhaus Zürich sehen und hören, was mir dieses Jahr unmöglich war.
Köbi Gantenbein, Fläsch, Schweiz