
Eine Care-Gesellschaft soll also entstehen und der Weg dorthin verlangt, so sind die beiden Autoren überzeugt, nach nichts Geringerem als einer Service-public-Revolution. Die bürgerlichen und wirtschaftsliberalen Reaktionen auf diesen Vorschlag kann man sich leicht ausmalen: Das sei doch, bei genauerer Betrachtung, nichts, als die alte, linke Leier von der großen Umverteilung; hohe Spitzensteuersätze, ein aufgeblähter Staat, Sozialindustrie statt Produktivität, Regulierungswahn statt freiem Spiel der Märkte. In der Tat sind weder Ringgers und Wermuths Analyse noch ihre Ideen alle ganz neu – das macht sie aber nicht falsch und die Kritik an ihnen nicht richtiger, ganz im Gegenteil, handelt es sich doch dabei teils um bewährte Ideen, die tief in der sozialdemokratischen Tradition verwurzelt sind und in besseren Jahren, in denen es den Gesellschaften gelungen ist, die Ungleichheit zu reduzieren, ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt haben.
Auffällig ist aber, dass selbst unter Sozialdemokraten und ihnen nahestehenden Denkern eine Scham zu existieren scheint, ihre Rezepte gegen die wachsende Ungleichheit als das zu bezeichnen, was sie sind – nämlich sozialdemokratische Politik. Nur ein einziges Mal kommt der Begriff der Sozialdemokratie im Buch vor, in Cédric Wermuths Autorenbiografie. Und in Beat Ringgers Biografie taucht ein einziges Mal der Name seiner Partei, die Grünen, auf. Vermutlich ist der Verzicht auf diese Begriffe ganz bewusst geschehen, weil das Buch ja kein Parteiprogramm sein soll. Interessanterweise kommen aber auch die Begriffe »links« oder »Linke« nur ein, zwei Mal vor.
Die Hemmung scheint mir symptomatisch für den Zustand der Sozialdemokratie und der Linken überhaupt. Auch Piketty traut dem Begriff der Sozialdemokratie nicht mehr und ersetzt ihn durch den Begriff des partizipativen Sozialismus. Diese Ablehnung ist zweifellos als Bruch mit dem Irrweg der Sozialdemokratie in den Neunzigern zu verstehen. Bei allem Verständnis dafür, verbinde ich damit aber eine doppelte Befürchtung.
Zum einen scheint mir damit eine Anschlussfähigkeit aufgegeben zu werden, an Zeiten, in denen einige der im Buch präsentierten Ideen weit weniger radikal wirkten, als sie das heute, nach 40 Jahren neoliberaler Dominanz, tun. Zum Beispiel Spitzensteuersätze bis zu neunzig Prozent für Ultrareiche, die uns heute wie ferne Utopien vorkommen, waren in den 60er Jahren Realität. Überhaupt kann man doch eigentlich kaum oft genug darauf hinweisen, dass all die gesellschaftlichen Errungenschaften, die uns heute ganz selbstverständlich vorkommen, die Arbeitslosenversicherung, das solidarische Gesundheitswesen, die AHV, ein einigermassen egalitäres Schulsystem, der Mutterschutz etc., genuin sozialdemokratische Ideen sind, die oftmals gegen den erbitterten Widerstand der Konservativen und Wirtschaftsliberalen erkämpft werden mussten.
Zum anderen drohen wir damit auch die Ursprünge der Sozialdemokratie ausser Acht zu lassen, die sich in den frühen Arbeitervereinen findet. Und diese waren in erster Linie Arbeiterbildungsvereine. Bildung wurde dabei als Selbstermächtigung verstanden und diente nicht zuletzt auch der Reflexion der eigenen Ressentiments. Wenn genuin linke Politik als echte Alternative zu den Verlockungen der Rechtspopulisten und Nationalisten und der Orthodoxie der Neoliberalen gelten soll, dann kommen wir nicht umhin, genau dort wieder anzusetzen: bei der Idee der Selbstermächtigung durch solidarische Bildung, bei der Idee, der Einzelne schaffe sich selbst, aber nicht in der dauernden Abgrenzung zum Anderen, nicht im pausenlosen Wettstreit, dafür in der solidarischen Gemeinschaft.[1]
Dankbar bin ich den Autoren, dass sie den Begriff des Klassenkampfes aufgreifen, der allzu leichtfertig von allen Seiten als obsolet erklärt wurde. Dabei liegt das Faktum eines Kampfes zwischen denen, die im Übermass haben, und jenen, die zu wenig haben, ganz offensichtlich zutage. Das Verhältnis zwischen Armen und Reichen ist, um mit Büchner zu sprechen, das einzige revolutionäre Element in der Welt – und damit auch unsere einzige Hoffnung, dass das falsche Selbstverständnis, mit dem sich der neoliberale Geist in der Mitte der Gesellschaft eingenistet hat, endlich in der breiten Masse hinterfragt wird und Platz entsteht für die Verwirklichung von Ideen, wie sie die beiden Autoren im dritten Teil ihres Buches formulieren.
Überhaupt griffe der Vorwurf, es liesse sich in dem vorliegenden Buch nur altbekannte linke Analysen und Rezepte finden, zu kurz, gelingt es doch den Autoren in ihrer Zustandsanalyse, neue Aspekte, die mit der ganz aktuellen Pandemiekrise zutage treten, herauszuarbeiten und mit einigen sehr praxisnahen, neuen Lösungsansätzen zu verbinden. Und dort, wo wir es tatsächlich mit altem Wein in neuen Schläuchen zu tun haben, lohnt es, sich in Erinnerung zu rufen, dass manch guter Wein mit dem Alter nur besser wird.
Jonas Lüscher, Schriftsteller und Essayist
[1] Dazu Gleb Albert: ›Neue Menschen‹ oder Jubelmasse? Die Rechte, die Linke und die ›kleinen Leute‹, www.geschichtedergegenwart. Abgerufen am 18. 8. 2020.

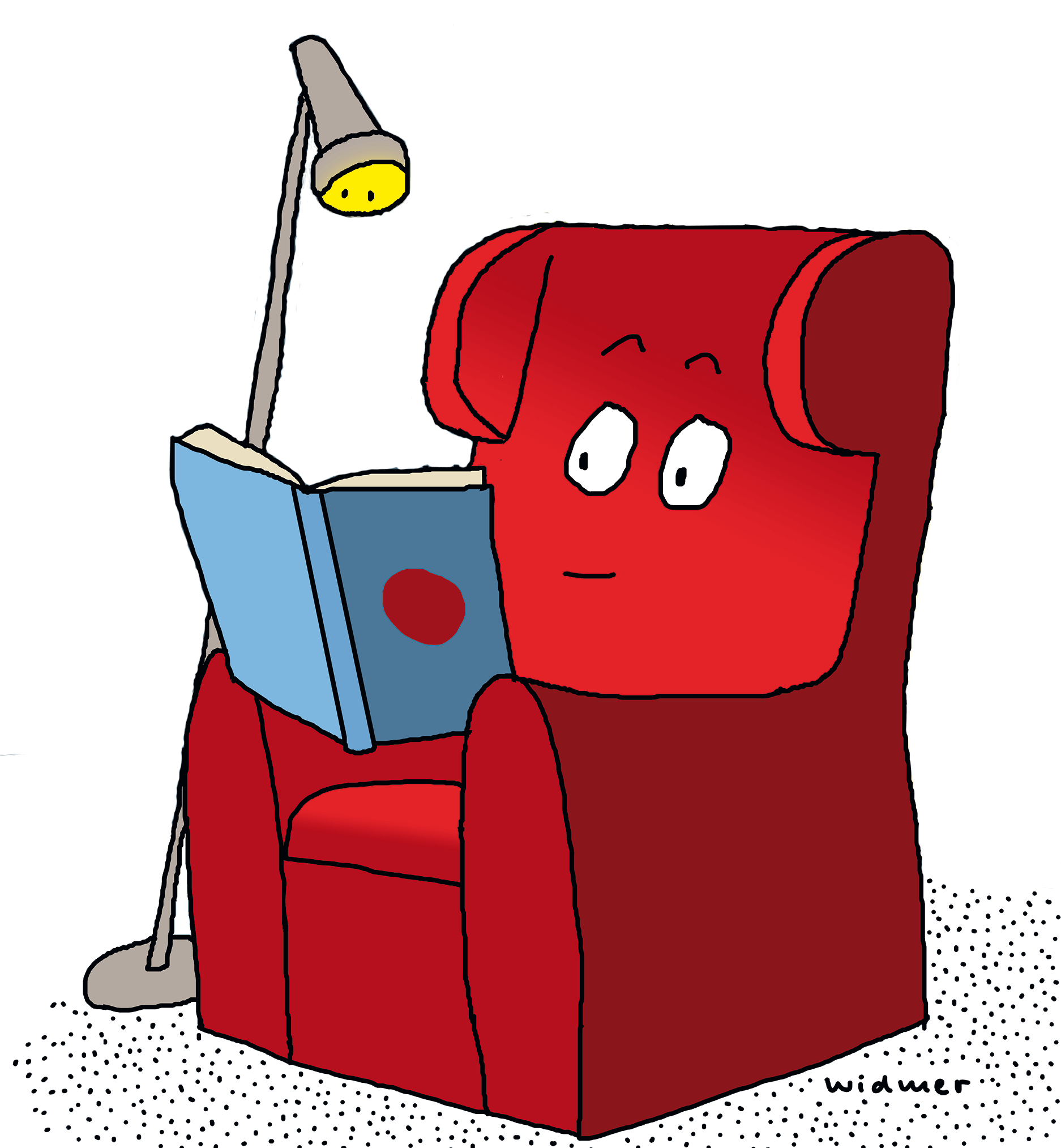
Noch keine Kommentare vorhanden.
KOMMENTAR SCHREIBEN
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung wird Ihr Kommentar von unserer Redaktion geprüft. Pflichtfelder sind mit einem * markiert.