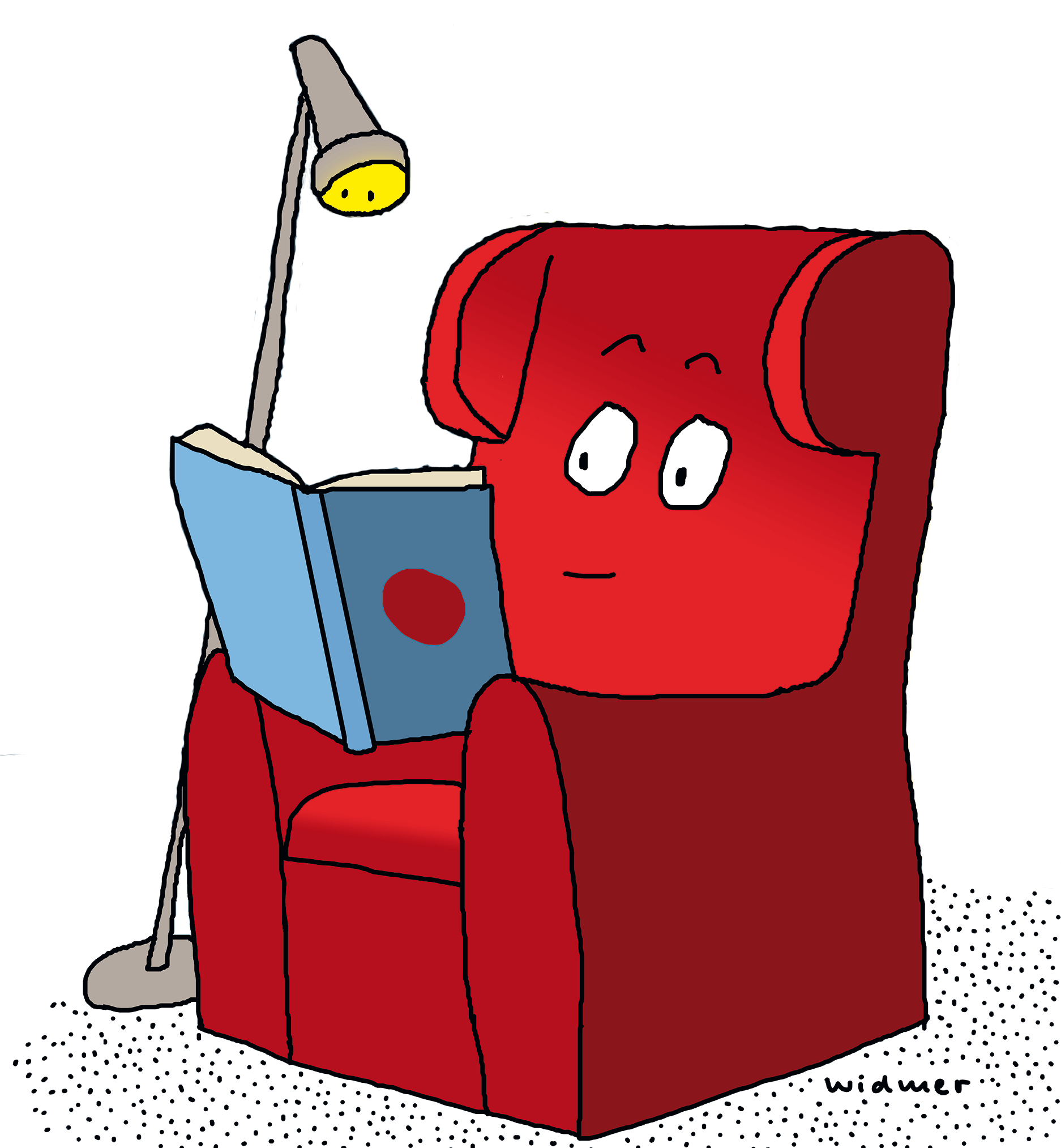Originale Version auf Französisch unten
Von diesem Fenster aus werde ich gleich, um 20 Uhr, dem Pflegepersonal applaudieren. Gegenüber werden sich im Licht einer Wohnung die Umrisse von Menschen abzeichnen. Jeden Tag sind es mehr. Seit kurzem werfen einige einen kurzen Gruß herüber. Darin besteht die Herausforderung der Quarantäne: Sympathien bei den Bewohnern der Hausnummer 90 zu gewinnen, die bisher eher aufgebracht sind gegen uns in 90 a – für sie eine Bande grölender Pennbrüder und unzurechnungsfähiger Idealisten. Und, in der Tat, das sind wir auch, mehr oder weniger. Ein Heim, wo Obdachlose eine Zeit lang zur Wiedereingliederung leben, für höchstens drei Jahre, laut Statuten, in Wirklichkeit auch manchmal länger. Allerdings ein Heim ohne Aufsichts- und Reinigungspersonal, sondern eine Wohngemeinschaft mit Leuten wie mir, vor allem junge Freiberufler, Doktoranden, die, soweit es eben geht, den Haushalt schmeißen und die Versorgung sicherstellen. Eine denkbar unmögliche Nachbarschaft für die Bewohner der Nummer 90, aber so etwas wie eine Familie für die, die hier leben oder gelebt haben. So wie ich; als man mich anrief und fragte, für die Zeit der Quarantäne einzuspringen, habe ich nicht lange überlegen müssen. Die Jungen wollten sowieso alle bleiben. Beim Öffnen der Fensterläden habe ich Julien gesehen, wie er seinen Rollstuhl vor sich herschob, durch den er sich mit seinen hundertfach gebrochenen Knochen aufrecht halten kann. Das Eingesperrtsein ist sein Alltag. Ihn dort im Tageslicht zu sehen, ist ein Wunder, wie die Erscheinung eines Polarwolfs. Er ist blass, unwiderstehlich charmant, ein ehemaliger singender Kinderstar, der am Showbusiness zerbrochen ist. Das Virus ängstigt ihn sehr, haben mir die anderen erzählt. Wenn man nur noch die eigene Haut zu verlieren hat, hängt man an ihr. Keine Angst zu haben, erweist sich nun als ein ziemlicher Luxus. Am Fenster nebenan raucht Noha eine Zigarette. Unter normalen Umständen würde ich meckern und er mich zum Teufel schicken. Heute habe ich nur das Fenster zugemacht. Das ist die zweite Herausforderung bei der Quarantäne zu dreißig: das Aufkommen von Frust zu vermeiden. Ich habe für diesen Fall einen kleinen Vorrat an Bier und Zigaretten für die, die keine Sozialhilfe beziehen oder keinen kleinen Job machen können. Gegen drei Uhr kommen Yohan und Pascal, um eins zu kippen, und erzählen mir Witze.
Von diesem Fenster aus werde ich gleich, um 20 Uhr, dem Pflegepersonal applaudieren. Gegenüber werden sich im Licht einer Wohnung die Umrisse von Menschen abzeichnen. Jeden Tag sind es mehr. Seit kurzem werfen einige einen kurzen Gruß herüber. Darin besteht die Herausforderung der Quarantäne: Sympathien bei den Bewohnern der Hausnummer 90 zu gewinnen, die bisher eher aufgebracht sind gegen uns in 90 a – für sie eine Bande grölender Pennbrüder und unzurechnungsfähiger Idealisten. Und, in der Tat, das sind wir auch, mehr oder weniger. Ein Heim, wo Obdachlose eine Zeit lang zur Wiedereingliederung leben, für höchstens drei Jahre, laut Statuten, in Wirklichkeit auch manchmal länger. Allerdings ein Heim ohne Aufsichts- und Reinigungspersonal, sondern eine Wohngemeinschaft mit Leuten wie mir, vor allem junge Freiberufler, Doktoranden, die, soweit es eben geht, den Haushalt schmeißen und die Versorgung sicherstellen. Eine denkbar unmögliche Nachbarschaft für die Bewohner der Nummer 90, aber so etwas wie eine Familie für die, die hier leben oder gelebt haben. So wie ich; als man mich anrief und fragte, für die Zeit der Quarantäne einzuspringen, habe ich nicht lange überlegen müssen. Die Jungen wollten sowieso alle bleiben. Beim Öffnen der Fensterläden habe ich Julien gesehen, wie er seinen Rollstuhl vor sich herschob, durch den er sich mit seinen hundertfach gebrochenen Knochen aufrecht halten kann. Das Eingesperrtsein ist sein Alltag. Ihn dort im Tageslicht zu sehen, ist ein Wunder, wie die Erscheinung eines Polarwolfs. Er ist blass, unwiderstehlich charmant, ein ehemaliger singender Kinderstar, der am Showbusiness zerbrochen ist. Das Virus ängstigt ihn sehr, haben mir die anderen erzählt. Wenn man nur noch die eigene Haut zu verlieren hat, hängt man an ihr. Keine Angst zu haben, erweist sich nun als ein ziemlicher Luxus. Am Fenster nebenan raucht Noha eine Zigarette. Unter normalen Umständen würde ich meckern und er mich zum Teufel schicken. Heute habe ich nur das Fenster zugemacht. Das ist die zweite Herausforderung bei der Quarantäne zu dreißig: das Aufkommen von Frust zu vermeiden. Ich habe für diesen Fall einen kleinen Vorrat an Bier und Zigaretten für die, die keine Sozialhilfe beziehen oder keinen kleinen Job machen können. Gegen drei Uhr kommen Yohan und Pascal, um eins zu kippen, und erzählen mir Witze.
Sie erleben grad ein lustiges Abenteuer. Im Heim herrscht Hochbetrieb. Die Jungen arbeiten am Bildschirm in den Büros der Sozialarbeiter, während die dasselbe von zu Hause aus tun. Es gibt immer jemanden, der Nachrichten schaut, der Macron als Diktator beschimpft oder am unverhofften Kicker steht, der irgendwie am Gare de Lyon aufgetrieben werden konnte.
Unsere neuste Aufgabe und nicht die geringste: alle im Haus zu behalten, zum Schutz vor dem Virus. Wie das Leuten klarmachen, die keinen Schutz vor gar nichts hatten, jahrelang? Oder denen, die zu fünfzig auf einem Gummiboot das Mittelmeer überquert haben? Zum Beispiel eine der Frauen vom dritten Stock. Sie will auf den afrikanischen Markt in Château Rouge. Sie braucht die kleinen Auberginen, nicht die dicken, wie wir, die Weißen, sie essen. Die Polizei ist überall, sie riskiert viel, wenn sie am anderen Ende von Paris aufgegriffen wird. Was soll sie schon riskieren, wenn sie ohne das Stück Papier, das sie noch nicht einmal lesen kann, aus dem Haus geht? Sie muss lachen, aber unterschreibt es uns doch, dieses verdammte Papier, mit einem einfachen Kreuz. Und sie kommt zurück, ohne Probleme, aber mit einer großen Tüte kleiner Auberginen. Auch Marco hat schließlich das Formular unterschrieben, ist aber ohne losgegangen und kommt auch ohne Probleme zurück. »Mir doch egal, ich bin sowieso nicht zahlungsfähig«, entgegnet er, als wir ihn auf die hohen Strafen hinweisen.
Aus den anderen Einrichtungen in Paris erreichen uns schreckliche Nachrichten: fünf oder sechs Erkrankte auf einem Zimmer, Leichen, die 24 Stunden lang nicht abgeholt werden, die Polizei, die sich weigert, hereinzukommen; Müll, der sich auftürmt, die Pflege- und Reinigungsdienste, die kein Personal mehr schicken. Kein einziger Fall, keine Symptome bei uns bis jetzt. Heute Abend haben wir Alles außer gewöhnlich geschaut, und wir haben uns wiedererkannt.
------
------
De cette fenêtre, tout à l’heure à vingt heures, j’applaudirai le personnel soignant. D’en face surgiront des silhouettes se découpant de la lumière d’une pièce. Elles sont chaque jour plus nombreuses. Depuis peu, certaines nous lancent un petit bonjour. C’est notre défi du confinement : nous faires aimer des locataires du 90, jusqu’à présent très remontés contre nous, au 90 bis, qu’ils voient comme une bande de clodos gueulards et d’idéalistes irresponsables. De fait, c’est ce que nous sommes, plus ou moins. Un foyer où des sans-abris viennent vivre un temps de réhabilitation, de maximum trois ans selon les statuts, totalement aléatoire dans la réalité. Mais un foyer sans gardiens ni personnel de nettoyage, la cohabitation avec des gens comme moi, surtout des jeunes professionnels ou des doctorants, permettant d’assurer bon an mal an le ravitaillement et le ménage. Un impossible voisinage pour les habitants du 90, mais une sorte de famille pour ceux qui y vivent ou y ont vécu. C’est mon cas, et je n’ai pas hésité à faire ma valise quand on m’a appelée à la rescousse pour le confinement. Quant aux jeunes, tous ont choisi de rester.
En ouvrant les volets, j’ai vu passer Justin en train de pousser le fauteuil roulant qui lui permet de tenir debout sur ses jambes mille fois fracturées. Le confinement, c’est son quotidien. Le voir à la lumière du jour est aussi miraculeux qu’une apparition de loup des neiges. Il est d’une pâleur de cierge, irrésistible de charme, ex-enfant chanteur que le showbiz a brisé menu. Le virus le terrorise ai-je appris de mes autres colocataires. Quand on n’a plus que sa peau, on y tient. Ne pas avoir peur est finalement un luxe comme un autre.
Juste à côté, Noha fume à sa fenêtre. En temps normal, je râlerais et lui m’enverrait paître. Aujourd’hui, j’ai simplement refermé. C’est le deuxième défi de ce confinement à trente : éviter la montée des frustrations. J’entretiens à cet effet un stock de bières et de cigarettes pour ceux qui n’ont pas touché leur RSA, ou qui sont privés de petits boulots au noir à l’extérieur. Vers quinze heures, Yohan et Pascal viennent s’en descendre une en me racontant des blagues. Eux vivent une parenthèse heureuse. La maison est pleine en permanence. Les jeunes télétravaillent depuis les bureaux des éducateurs qui télétravaillent de leur appartement. Il y a toujours quelqu’un pour regarder le téléjournal, traiter Macron de dictateur ou jouer au providentiel baby-foot qui a été récupéré je ne sais comment Gare de Lyon.
Notre dernière mission, et pas des moindres : maintenir tout le monde à l’intérieur, à l’abri du virus. Allez expliquer ça à des gens qui n’en ont pas eu d’abri, pendant des années ! Ou à ceux qui ont traversé la Méditerranée à plus de cinquante sur un bateau pneumatique. C’est là cas d’une des femmes du troisième. Elle veut aller au marché africain à Château Rouge. Il lui faut des petites aubergines, pas les grosses comme nous mangeons nous, les Blancs. La police est partout, elle risque gros si elle se fait prendre à l’autre bout de Paris. Risquer gros, à sortir sans un bout de papier qu’elle ne peut même pas lire ? Ça la fait rire, mais elle nous le signe tout de même ce foutu papier, d’une simple croix. Et elle nous revient sans encombre, avec tout un sac de petites aubergines. Marco aussi a fini par signer une autorisation de sortie. Mais il est parti sans, et nous revient sans problème lui aussi. « M’en fous, je ne suis pas solvable », nous rassure-t-il quand nous lui indiquons le montant des amendes.
Des autres foyers parisiens nous arrivent des nouvelles effroyables : des malades à cinq ou six par chambre, des corps restés 24 heures sur place, la police refusant d’entrer, les déchets qui s’entassent, les entreprises de ménage et de gardiennage se refusant d’envoyer leurs employés. Pas le moindre cas ni symptôme chez nous pour l’instant. Ce soir nous avons regardé « Hors normes », et nous nous y sommes reconnus.
Pascale Kramer, Paris, Frankreich
Aus dem Französischen von Daniela Koch