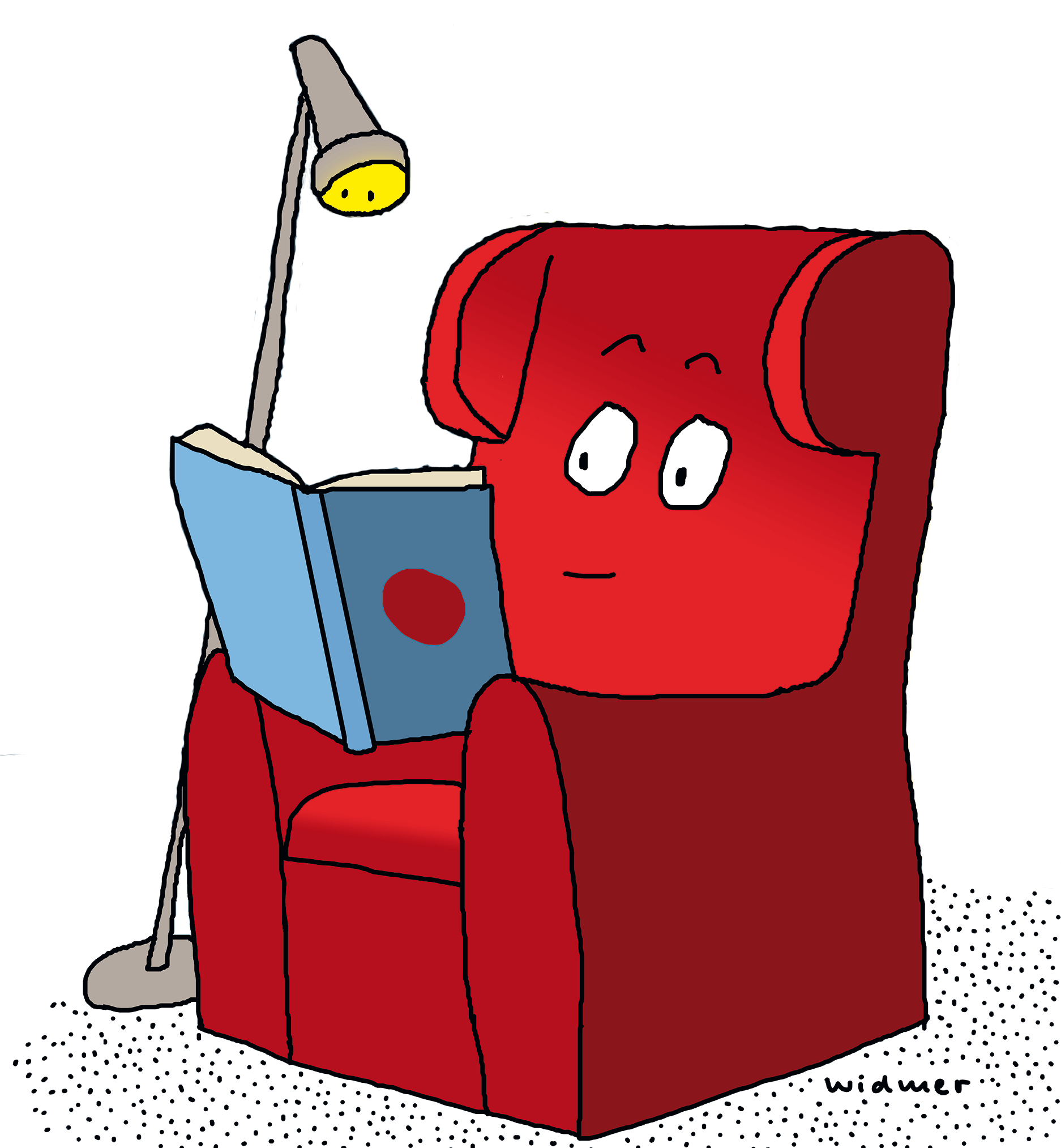Es ist kurz nach elf. Die Nachrichten im Radio über die vom Bundesrat im Kampf gegen die Corona-Krise ausgerufene »außerordentliche Lage« sind verklungen. Wir steigen aus dem Auto, nehmen die Rucksäcke aus dem Kofferraum und überqueren die Straße. Über uns der wolkenlose, hellblaue Himmel. Ein Traktor fährt über ein Feld. Eine Krähe flattert auf und fliegt davon. Dann ist es wieder still. Wir gehen über einen Holzsteg, tauchen in einen lichten Nadelwald ein und nähern uns einem ganz und gar zauberhaften Ort: dem Etang de la Gruère.
An der ersten Weggabelung biegen meine Tochter und mein Sohn links ab. Ich folge ihnen. Wir gehen ein Stück weit am Ufer entlang, weichen den schlammigen Wegabschnitten aus, schreiten erneut über einen Holzsteg. Hin und wieder sehen wir ein paar Menschen: ein junges Paar auf einem Holzstumpf, das eng umschlungen auf den glitzernden Teich blickt; zwei Mädchen, die einen Mops spazieren führen, der meine Kinder beschnuppert; einen weißhaarigen Mann, der mit dem Fahrrad an den See gefahren ist und in einem sonderbaren, schaumgummiartigen Ding liegend ein Buch in der warmen Sonne liest. Verwundert betrachte ich den Mann. Nachdem in den letzten Tagen viele meiner Auftritte abgesagt wurden, kommt mir der lesende Fahrradfahrer beinah wie eine vom Aussterben bedrohte Tierart vor. Wehmut überkommt mich für einen kurzen Moment. Dann gehe ich weiter, den Kindern hinterher.
Nach zwanzig Minuten erreichen wir den Ort, an dem wir bereits bei unserem letzten Besuch länger Rast gemacht haben. Ich suche eine flache, wurzellose Stelle in Wassernähe, breite die Picknickdecke aus, nehme die Brote, die Thermosflasche aus dem Rucksack und lege sie auf die Decke. Derweil erforschen die Kinder den Wald, stecken ein paar Steine in ihre Jackentaschen, halten nach Tieren Ausschau, erklimmen ein riesiges, senkrecht in die Luft ragendes Wurzelgeflecht eines kürzlich umgestürzten Baumes.
Als wir später zu dritt nebeneinander auf der Decke liegen und durch die Äste einer Weißtanne in den Himmel blicken, frage ich Elaine, ob sie sich daran erinnere, wie wir vor gut vier Jahren im Winter zum ersten Mal am Etang de la Gruère waren.
»Aber klar«, entgegnet sie, sie wisse noch genau, wie sie hier das Schlittschuhlaufen gelernt habe. Und sie fährt fort: »Eine ganze Woche lang sind wir jeden Tag hierhergekommen, sind übers Eis gefahren. Und am Schluss konnte ich es.«
»Ja, genau so war’s«, stimme ich ihr zu, erfreut über die gemeinsame Erinnerung.
Und dann sehe ich Elaine wieder vor mir. Wie sie als Vierjährige auf wackligen Beinen steht. Wie sie die Arme seitlich vom Körper hält, sich ruckartig fortbewegt. Wie sie immer wieder umfällt, sich von niemandem helfen lässt, sondern selber, mit eigener Kraft, ein ums andere Mal aufsteht. Und weitermacht. Einfach weitermacht. Bis sie von einem Ende des Teichs zum anderen gelangt. Und von dort wieder zurück. Und das sieben Tage nacheinander. Den vielen blauen Flecken und der Wut zum Trotz, die manchmal in ihr hochsteigt, weil sie das Schlittschuhlaufen noch rascher lernen will. Damals habe ich mir geschworen, ihren so überaus starken Willen zu schützen, solange es nur irgendwie geht.
»Und wo war ich?«, will Leo wissen, als wir uns ans Zusammenpacken machen.
»Im Kinderwagen«, antwortet Elaine.
»Ja«, ergänze ich, »du, Leo, hast am Rand der Eisfläche oft stundenlang im Kinderwagen geschlafen. Manchmal ist Mama oder bin ich mit dir im Arm übers Eis gefahren und du hast vor Freude gesummt.«
Leo schaut mir entschlossen in die Augen: »Ich will auch Schlittschuh laufen!«
Dann brechen wir auf, machen eine Runde um den Teich. Die meisten Leute, die uns begegnen, nicken zum Gruß. »Bonjour« und »Grüess ech« sind heute rar. Dennoch wird mir mit jedem Schritt leichter ums Herz. Ja, inmitten dieses ganz und gar wundersamen Kosmos des Etang de la Gruère und gestärkt von der Erinnerung an magische Wintertage weicht das Gefühl der Benommenheit, das ich seit Tagen angesichts der sich zuspitzenden Pandemie empfinde, einer vagen Zuversicht.
Als wir wieder im Auto sind, sehen wir den lesenden Fahrradfahrer noch ein letztes Mal. Mit seinem hellblauen, bettähnlichen Anhänger biegt er von der Seitenstraße, die vom Teich herführt, in die Hauptstraße ein und fährt langsam hangabwärts in Richtung Saignelégier davon. Vielleicht, denke ich, ist das weniger eine Lebensform, die bald verschwindet, als eine, die in die Zukunft weist. Dann drehe ich den Zündschlüssel, mache das Radio an und lege die CD ein, die sich die Kinder immer wünschen. Wir beginnen im Chor zu singen und fahren los. »One, two, three, four / Can I have a little more? / Five, six, seven, eight, nine, ten / I love you.«
Rolf Hermann, Biel/Bienne, Schweiz