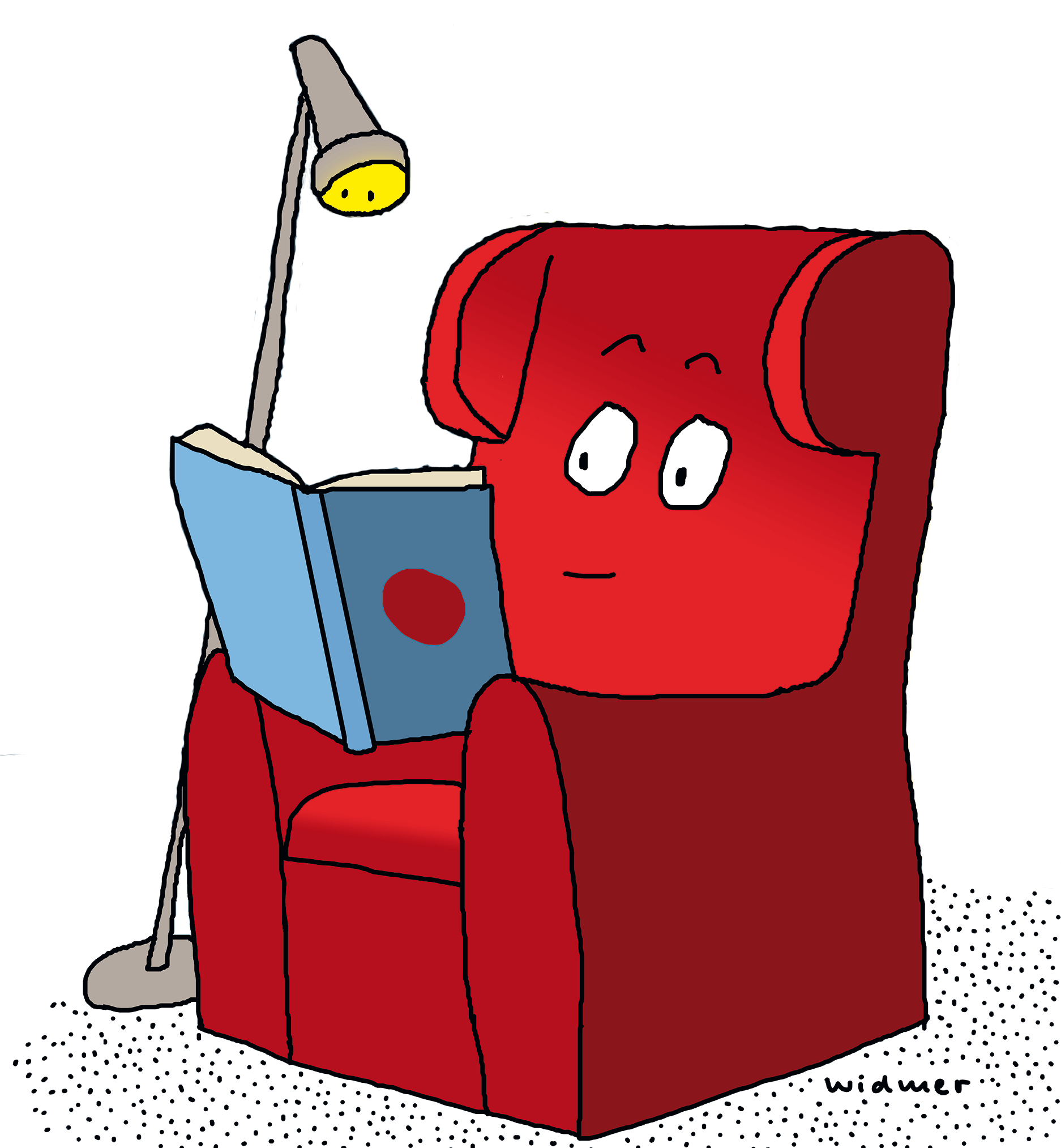Der Tag beginnt mit ungewohnter Stille.
Von der Großbaustelle, auf der das höchste Hochhaus des Landes entstehen soll, dringt heute kein Sirren von Kranen hinüber, kein Hämmern, kein Betoniergeräusch. Meine Verwunderung über die seltsame Ruhe geht erst mal unter in den Morgennachrichten, die mich fluten mit noch mehr Ansteckungszahlen, noch mehr gezählten Toten; aber später am Tag erfahre ich von einer Bekannten, dass man über die Fortführung der Arbeit auf der Großbaustelle verhandle, darum stehe alles still. Der Bauunternehmer, erzählt die Bekannte, habe darauf bestanden, dass die Arbeiter auf der Baustelle erschienen, Corona hin, Corona her, die Gewerkschaft, offenbar, war anderer Meinung. Ihr eigener Mann sei jeden Tag auf dieser Großbaustelle zur Arbeit erschienen, obwohl drei Arbeiter am Virus erkrankt seien und obwohl er nach seiner Chemotherapie zur Risikogruppe gehöre; die Bauunternehmung habe ihren Mann nur von der Arbeit dispensieren wollen, wenn er auf die angelaufenen Überstunden und auf sein Ferienguthaben verzichte, erzählt sie.
Diese Krise bringt tiefe Strukturen zum Vorschein.
Beim Frühstück sehe ich auf meinem kleinen schwarzen Ding, dass ich den Anruf meines Freundes Yaya aus Bamako verpasst habe, Yaya, mit dem ich Ewigkeiten nicht gesprochen habe, er meldet sich, gerade jetzt. Für einen Augenblick habe ich das Bild des Hôpital Gabriel Touré in Bamako vor mir, ich sehe die überquellenden Wartezonen, Kranke, die in Korridoren auf Matten liegen, Operationssäle ohne Fenster. Der Gedanke lässt mich nicht mehr los, was geschieht, wenn das bösartige Virus ein Land wie Mali erreicht, eine Stadt wie Bamako; die Krise entblößt, wie andere auch, Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf eine obszöne Art.
Allen, die es wissen wollen, weise ich dieser Tage auf die kurze, brilliante Analyse von Naomi Klein in The Intercept hin, die aufzeigt, wie unterschiedlich die Krise Menschen aus verschiedenen Schichten trifft. Was es heißt, wenn man als schlecht bezahlte, nicht versicherte, alleinerziehende Serviceangestellte vom Virus getroffen wird; und wie (auf der anderen Seite) die Reichen aus den krisenhaften Verwerfungen ihren Profit ziehen. Im Hintergrund, mahnt Naomi Klein, werden die Karten neu gemischt; nun gelte es, sich diesen Machenschaften entgegenzustellen. Dringlich fordert sie uns auf, aus der Mitte der Gesellschaft heraus eigene, frische Ideen für eine neue, eine andere Zukunft zu entwickeln.
Arbeiten hilft, arbeiten an Möglichkeitsformen.
Ich feile, gemeinsam mit einer kleinen Redaktionsgruppe, an einem Podcast (»treibhaus«), der von den strukturellen Gemeinsamkeiten der Klimakrise und der Corona-Krise handeln soll. Die Ergänzungen, Korrekturen, Anregungen zum Text, die aus der Gruppe per Mail eintreffen, zeigen, dass alle dieselbe Frage umtreibt – wie es weitergehen wird mit der Debatte zur Klimakrise, wenn die Krise mit Covid-19 einmal ausgestanden ist. Ob sich die Idee einer nachhaltigen, klimagerechten, partizipativen Lebensform und Wirtschaft durchsetzen wird, wie der Zukunftsforscher Matthias Horx etwas übereifrig erwartet, oder ob sich, wie der Historiker Yuval Noah Harari warnt, lange schon schlummernde krass autoritäre, nationalistische, neoliberale Haltungen durchsetzen könnten. Schwierig, die richtigen Worte zu finden für diesen Podcast und zu vermitteln, dass es auf uns ankommt, auf uns Bürgerinnen und Bürger, wie die Welt nach der Krise aussehen wird.
Fragt sich nur, wie es uns dann gehen wird.
Noch keine Woche ist es her seit dem Lockdown, und bereits zeigen sich Anzeichen von seltsamen Zuständen.
Eine Kollegin, die als Videoreporterin arbeitet, sitzt seit Tagen zu Hause, ganz allein, wir telefonieren sehr lange, ich merke, dass sie nicht auflegen will. Ein Freund berichtet von unendlich langen, stressigen Seminaren über irgendwelche Streamingprogramme, er ist mit den Nerven am Ende, auch er hört nicht auf zu reden. Mit einer Freundin spreche ich darüber, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu umarmen, und wie schnell es geht, bis man dieses Gefühl verliert. Nachdem ich erfahre, dass eine Kollegin ihren Vater ans Virus verloren hat, klaube ich auf meinem kleinen schwarzen Ding nach Worten des Trostes und schaue mir dabei zu.
Wer werden wir sein, am Ende dieser Krise, was wird sie mit uns gemacht haben, frage ich mich.
Und ob die vielen Zeichen von Freundschaft, von Zuneigung, all die humorvollen Zuschriften (das Klinikum in Kiel schreibt auf einem Plakat: »Wasch deine Hände, als hättest du gerade Chili geschnitten und wolltest jetzt masturbieren«), all die solidarischen Aufrufe, ob sie uns hinüberretten werden durch diese Quarantäne. Ob wir dann noch die Kraft haben werden, um uns um das Liegengebliebene zu kümmern, um die noch größeren Krisen, die da harren.
In den Abendnachrichten höre ich, dass der Senat in Washington das »Corona-Hilfspaket« des brabbelnden, orangenhäutigen Präsidenten verworfen hat; das Paket sei nichts als ein »gigantischer Fonds für Großkonzerne« gewesen, sagte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren zur Begründung.
Immerhin.
Christoph Keller, Basel, Schweiz